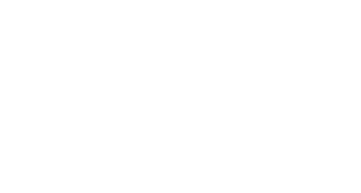Aktuelles
Vom 17.-19.02.2025 fand die 27. Jahrestagung der Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für Hermeneutische Theologie statt.

„Es liegt offenkundig viel an der Kindheit“
„'Kinder Gottes'. Kindheit theologisch denken“ war das Thema der Jahrestagung 2025 der Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für hermeneutische Theologie e.V.
„Es liegt offenkundig viel an der Kindheit: letztlich der Zugang zur Gottheit, zu dem Ewigen.“ Das sagte der Vorsitzende der Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für Hermeneutische Theologie e.V., der Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Philipps-Universität Marburg Dr. Malte Dominik Krüger in seiner Begrüßung zur 27. Jahrestagung der Gesellschaft, die vom 17. bis 19. Februar 2025 in der Evangelischen Tagungsstätte Hofgeismar zum Thema „´Kinder Gottes´. Kindheit theologisch denken“ durchgeführt wurde. Vor den rund 70 Teilnehmer*innen aus Wissenschaft und Kirche bezog sich Krüger auf die Perikope vom Rangstreit unter den Jüngern in Mt 18,1-5 „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“ und fragte: „Wie können auf der einen Seite das ´Kind Gottes´ und die Gotteskindschaft des Glaubens und auf der anderen Seite das ´Kind´ und Lebensalter eines heranwachsenden Menschen aufeinander bezogen werden?“ Und „was ist mit der ´Gotteskindschaft´ heute gemeint – und inwieweit wollen wir Kinder als theologische Subjekte einbeziehen?“ Auch stelle sich die Frage, was dies für die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gemeinde- und Bildungsarbeit bedeutet. Verschärft würden diese Fragen dadurch, „dass der Missbrauch von Kindern in der Kirche sehr viel entschiedener bekämpft werden soll und der Kirche keine Zukunft ohne Kinder verheißen ist“. Schließlich dankte Krüger der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die diese Tagung finanziell unterstützt habe.Ihrerseits Dank für die Aufnahme dieses Themas sprach die Leiterin der Bildungsabteilung der EKD Oberkirchenrätin Dr. Birgit Sendler-Koschel, Hannover, in ihrem Grußwort aus. Koschel erinnerte an den Grundlagentext der EKD zum Thema Kind, Kindheit von 1994 mit dem Titel „Aufwachsen in schwieriger Zeit“ sowie an die UN-Kinderrechtskonvention und sagte: „Wenn wir theologisch die Metapher von der Gotteskindschaft nutzen, evozieren unsere Rede oder unser Schreiben Bilder.“. Diese seien „durch die kulturellen Codes unserer Gesellschaft und Kirche, durch die darin tradierten Bilder von Unfertigkeit und Unmündigkeit, Angewiesenheit und Beziehung der Kinder und der Kindheit geprägt“. Das trage mit dazu bei, „was wir auch in der Forschung zu Kindheit und Kindern in Daten sehen, denken, fragen und theologisch zum Ausdruck bringen“. Koschel versicherte: „Wir werden die Ergebnisse der Tagung mit großer Aufmerksamkeit nicht nur zur Kenntnis, sondern gerne in die aktuelle EKD-Arbeit aufnehmen.“
Ein neuer Fokus
In ihrem Vortrag „Kinder und Jugendliche. Perspektiven der Evangelischen Kirche in Deutschland“ richtete die Oberkirchenrätin Anfragen an die wissenschaftliche Theologie. Sie forderte die Ausarbeitung einer „Theologie der Kindheit, des Kindseins, der Gotteskindschaft“, die alle theologischen Fächer einschließt. Kinder seien ernst zu nehmen „als Akteure von Geburt an“. Es gehe um eine „theologische Anthropologie ohne Kindvergessenheit“, die den weiten Sachbereich „Schutz, Nahrung, Sorge, Förderung, Annahme, Liebe, Spiel Bildbarkeit, Entwicklung, Gestaltungsfreude und Gestaltungsfähigkeit“ als theologisches Thema erkenne.Sendler präsentierte umfangreiches statistisches Material, aus dem hervorgehe: „Es gibt keine Phase so stabiler Kirchenmitgliedschaft wie bei getauften Kindern und Jugendlichen bis in die Mitte bis Ende der 20er Lebensjahre hinein.“ Erforderlich sei ein „neuer Fokus“ für die kirchliche Arbeit mit Kindern: „Kinder leben in steter Minderheitssituation in der Gemeinde“, das gelte aber nicht an weiteren kirchlichen Orten wie Kitas, Schulen oder im Bereich der Freizeit- und Jugendarbeit sowie in Christenlehre und Kinderkirche.
Für die mittelfristige oder langfristiger Zukunft kirchlicher Arbeit mit und für Kinder beschrieb die Referentin drei mögliche Szenarien: Da die meisten Arbeitsfeldern mit Kindern im kirchlichen Raum in Bildungsmitverantwortung erfolgen, erheben sich erstens die Fragen „Werden wir weiter staatlich gefördert Kita, Schule, Religionsunterricht und evangelische Freizeiten veranstalten können? Wenn ja, was dann? Wenn nein: Was dann? Wie können wir auf beides vorbereitet sein?“ Ein zweites Szenario bestehe bereits jetzt in der Stärkung der Arbeitsbereiche, die die Kirche mit und für Kinder allein verantwortet. Ein drittes Szenario wäre die Bildung und der Ausbau ökumenischer Kooperationen mit Initiativen für Kinder, Familien und Kirche. So nehmen Projekte wie „Netzwerk Familie“ zusammen mit vielen Landeskirchen „Kinder als Akteure konzeptionell und in der Arbeit vor Ort aufmerksam in den Blick und eröffnen religiöse Erlebnis- und Gesprächsräume“.
Der Schlüssel zum Haus unseres Lebens
Krüger in seinem Vortrag „Anfänge und Vollendungen“. Krüger erinnerte an das Motiv des „göttlichen Kindes“ in Faust II (V. Akt) und bei Carl Gustav Jung, demzufolge es in der Mythologie das „göttliche Kind“ als eine „archetypische und paradoxe Gestalt des Menschlichen“ gebe, die sich durch Verlassenheit, Unüberwindlichkeit sowie Umfassendes auszeichnet und für einen Anfang und ein Ende steht.Eingehend analysierte Krüger den Forschungsstand in der fundamentaltheologischen Begründung einer Theologie des Kindes von Wolfhart Pannenberg bis Georgiana Huian sowie die Theologie des Sprach-Bildes bei Ernst Fuchs und Eberhard Jüngel, den Entwurf einer Hermeneutik des Bildes bei dem Philosophen Ferdinand Fellmann, die Metaphysik des Bildes bei Hans Jonas und die Vorstellung Sören Kierkegaards von einer anderen, zarteren, „nicht an die Gesetze der Schwerkraft gebundene Wirklichkeit – eine(r) Welt von höherer Realität als d(er) unsere(n)“. Der Referent resümierte: Für eine Theologie der Kindheit sind Einbildungskraft und Phantasie, die sich im Spiel ausdrücken, nicht nur wesentlich, sondern sie bestimmen grundlegend den christlichen Glauben und das Gottesbild Jesu Christi. In einer Theologie der Kindheit werde dies ausdrücklich auf Kinder hin und mit Kindern selbst bedacht. Denn: „Kinder haben den Schlüssel zu dem tragenden Untergeschoss in dem Haus unseres Lebens, den wir verloren haben und im Glauben wieder neu erlangen können.“
Krüger forderte: „Kirchlich könnte und sollte (…) der Gottesdienst so sein, dass in einer ´Inszenierung´“, in seinem ´Spiel´ das Staunen und Danken vor der Wirklichkeit Gottes geschehen kann – und in einem entsprechenden Lebensstil ausstrahlt.“ Dabei könnten für Erwachsene Kinder „selbst zu Gelegenheiten werden, die ins Staunen, Spielen und Danken führt und so zum ´Bild´ des Gottesreiches werden können“.
Die Fragilität des Kindseins
In die neueren Entwürfe der „child theology“ und einer „ökumenisch verstandenen Anthropologie“ führte die außerordentliche Professorin für Systematische Theologie und Ökumene am Institut für Christkatholische Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Bern Dr. Georgiana Huian in ihrem Vortrag „Kindsein und Gotteskindschaft. Zur Spannung zwischen Fragilität und Vollkommenheit“ ein.So seien Kindschaft und Gotteskindschaft in der child theology vom Begriff der Fragilität oder Vulnerabilität geprägt. Nach der Überzeugung des römisch-katholischen Theologen Hans Urs von Balthasar (1905–1988) sei das zentrale Geheimnis des Christentums „unsere Verwandlung von weltklugen, selbstgenügsamen ´Erwachsenen´ in Kinder des Vaters Jesu durch die Gnade seines Geistes ist.“ Im mariologischen Ansatz der russisch-orthodoxen Theologin und Nonne Maria Skobtsova (1891–1945) verstehe sich jedoch die Fragilität des Kindseins nicht nur in Beziehung zum göttlichen Vater, sondern auch im Verhältnis des Kindes zur leidenden Mutter und der Mutter zum leidenden Kind. Die Botschaft sei: Nicht die eigene Gotteskindschaft ist als ein individuelles Gut anzustreben, sondern die anderen sind als Kinder Gottes zu betrachten und an ihrem Leiden, d.h. an ihrer Fragilität, ist teilzuhaben. Beide Entwürfe wagen es, so Huian, „Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit in Vollkommenheitsmodelle strukturell einzuschreiben, wodurch sowohl Kindheit als auch Gotteskindschaft in der Dimension einer transformativen Fragilität neu gedacht werden“.
Auch die Sichtweise des niederländischen Historikers Johan Huizinga (1872-1945) auf die Rolle des Spiels in der Kultur, „blickt auf das Kindsein hinsichtlich des Spiels und überträgt das spielerische Werden auf das Leben vor, mit und in Gott“. Es gehe darum, „dass der Mensch sich mit Leidenschaft und Hingabe auf das Verhältnis zu Gott einlässt, wie ein Kind auf das Spiel“. Auch der Prozess des Gebens ist nach Huian „fundamental für Kindschaft als Teilhabe am Leben Gottes“.
Der vaterlose Sohn
In den meisten alttestamentlichen Beispielen zur Rede von der Kindschaft werden Vorstellungen aus dem Sozialraum Familie auf das Kollektivum Volk und sein Gottesverhältnis angewandt. Im Prophetismus wird dann die Rede vom Kind Gottes so ausgestaltet, dass die Texte eine starke emotionale Dichte, Ansprache und Plausibilität erzeugen. Das war die These des Vortrags „Exklusiv und emotional. Projektionsfläche Kindschaft im Alten Testament“ von Dr. Jürgen van Oooschot, Professor i.R. für Altes Testament an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die in den alttestamentlichen Texten verwendete Liebesmetaphorik und Aussagen zur Exklusivität der Beziehung zwischen Eltern und Kind, Volk und Gott schaffen, so Oorschot, „eine hohe Intensität und plausibilisieren, dass es sich um eine exklusive Beziehung handelt“. Dabei bestehe allerdings die Gefahr der Reduktion des Gottesverhältnisses auf ein Kind-Sein wie die einer Idealisierung des Vaterbildes.Kinder und damit die Nachkommenschaft der nächsten Generation bilden „die Grundlage jeder Form von sozialer und biografischer Absicherung“. In der politischen Theologie taucht das Kind, genauer der Sohn, im Zusammenhang von Königtum und Herrschaft auf. „Der universale Gott hat“, so der Referent, „im König einen Sohn, dieser Sohn hat (…) aber keinen Vater.“ In der alttestamentlichen Gerichtsprophetie, analog dazu in der deuteronomistischen Literatur, wird der Sohnestitel auf das Volk Israel übertragen und es findet sich eine Liebesmetaphorik: „Als Israel jung war, gewann ich es lieb, heraus aus Ägypten rief ich meinen Sohn.“ (Hos 11,1)
Dass der alttestamentliche Begriff der Kindschaft auch Ethik impliziert, zeigt vor allem, so van Oorschot, das Gebot zur Ehrung der Eltern im Dekalog (Ex 20,12/Dtn 5,16), was auch für das auf Israel und JHWH übertragene Vater-Sohn-Verhältnis gilt. Später, in Prophetie und Weisheit sowie in einer von dieser Weisheit beeinflusste Psalmenliteratur, kann dann auch der einzelne Gerechte oder Gottesfürchtige als Kind Gottes bezeichnet werden. Wenn, wie in Weish 5,5, gerettete Verstorbene zu den Söhnen Gottes zählen, verbindet sich Gotteskindschaft sogar mit Unsterblichkeit.
Die neue Familienzugehörigkeit
Im Neuen Testament impliziert die Metapher Kind Gottes „eine neue Familienzugehörigkeit, der Status darin hat aber nichts mit kindlichen Eigenschaften der Kinder Gottes zu tun (…), vielmehr wird von den Kindern Gottes das Verhalten von erwachsenen Kindern gefordert, relational, verantwortlich, respektvoll und loyal.“ Das erklärte die Professorin für Neues Testament an der Georg-August-Universität Göttingen Dr. Susanne Luther in ihrem Vortrag „Kindschaft als theologische Metapher im Neuen Testament“.Die Referentin ging aus vom Ansatz des „childist criticism“, der aufzeigen wolle, „dass Kinder im Neuen Testament nicht nur Randfiguren sind, sondern eine eigenständige, oft übersehene Rolle spielen“. Diese hermeneutische Forschungsperspektive zeige „dass Kinder zum einen häufig implizit in den Texten vorkommen, zum anderen auf einer der Erzählebene unterliegenden Ebene eine wichtige Rolle in den Evangelienerzählungen einnehmen“. So treten Kinder als aktive, manchmal schillernde Erzählfiguren auf, wie etwa die Dienerin des Hohenpriesters (kann terminologisch auch als „Kind“ gelesen werden, Mk 14,66) und nehmen eine zentrale Rolle ein, „von der Kindwerdung Gottes über die Kinder in der matthäischen Erzählung bis zur eschatologisch erwarteten ´Friedensherrschaft des Kindes´“. Dabei müssen Kinder immer auch als Metapher gelesen werden: „Sie stehen für die Zuwendung zu Jesus, zum Himmelreich, zu Gott.“
Das von Jesus in Mk 9,33-37 in die Mitte gestellte Kind ist Repräsentant der Geringsten, Kleinsten und Schwächsten und demnach ein Symbol für Gottes Herrschaft und seiner Umkehrung aller menschlichen Hierarchien. In der Erzählung von der Kindersegnung Mk 10,13-16 par soll nach der Lesart der childist criticism nicht der Glaubende das Reich Gottes aufnehmen, vielmehr ist das Reich Gottes so aufzunehmen, wie man ein Kind aufnimmt „mit Offenheit, Bereitschaft und Anerkennung seiner besonderen Stellung“. Nach Auffassung der neutestamentlichen Autoren bedeute ein Kind Gottes zu sein: „Das Verhältnis von erwachsenen Kindern soll sich (…) durch Verantwortlichkeit, Respekt und Loyalität auszeichnen. Man könnte in Bezug auf das von den Kindern Gottes geforderte Verhalten also von einer Kindschaftsethik sprechen.“
Das Klagen und Weinen der Kinder
„Mit der weitgehenden Ausblendung von Kindern ist ´Kirchengeschichte´ unvollständig und sie liefert damit keinen an ihrer eigenen Aufgabe gemessenen vollständigen Beitrag zum gesamttheologischen Diskurs. Deshalb ist es nicht trivial, über Kinder als Akteure in der Kirchengeschichte nachzudenken, sondern notwendig.“ Mit diesen Worten schloss der Privatdozent für Kirchengeschichte an der Universität Basel, Pfarrer Dr. Hans-Georg Ulrichs, seinen Vortrag zum Thema „Kindersensible Kirchengeschichte. Kinder als historische Akteure wahrnehmen.“ In einem energischen Apell trat Ulrichs für eine „kindersensible“ Kirchengeschichtsbetrachtung ein. Kinder historisch mitzuberücksichtigen könne ein kritisches Instrument sein, zu hinterfragen: „Wie verhalten sich die Erwachsenen jeweils in ihrem historischen Kontext zu den Kindern?“ Als Opfer in der Geschichte seien Kinder verschwiegen worden oder als Opfer in die Geschichte eingegangen „Es sind die Klagen und das Weinen der Kinder zu hören“ und die Schuld des Christentums an seiner Kinderunfreundlichkeit zu rekonstruieren.Als Quellen für eine kindersensible Kirchengeschichte nannte der Referent staatliche und kirchliche Akten sowie zeitgenössische Publikationen, aber auch Memoiren und Autobiographien sowie Ton-, Bild- und Filmaufnahmen, in denen Kinder „keine originären Stimmen“ haben. Ulrichs forderte: „Quellen müssten fortlaufend befragt werden, welche Konsequenzen das dort Erwähnte für Kinder zeitigte“. Und: „Es wäre sicher schon viel, wenn im gesamten theologischen Fächerkanon und in der scientific community darüber Konsens bestünde, dass Kinder als Subjekt anzusehen und deren Perspektiven mit zu berücksichtigen sind.“
Kinder als gesellschaftliche Ressource
Dass Kinder eine gesellschaftliche Ressource darstellen, die durch den demografischen Wandel immer kostbarer werde, darauf verwies die Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Philipps-Universität Marburg Dr. Hanna Christiansen in ihrem Vortrag „Was ist Kindheit? Einsichten aus der aktuellen Psychologie“. Die Gefährdung der mentalen Gesundheit von Kindern sei aber, „nicht ´nur´ ein individuelles und gesellschaftliches, sondern ein gravierendes volkswirtschaftliches Problem für den Standort Deutschland.“Zur Definition von Kindheit sagte die Referentin, es handle sich um Personen während der Entwicklungsspanne zwischen Geburt und dem Beginn der Erwachsenenreife. Die Entwicklungspsychologie der Kindheit befasse sich mit dem kindlichen Verhalten und Erleben in den ersten 10 bis 12 Jahren, einem Zeitraum, der stark durch Veränderungen geprägt sei. Im ersten Lebensjahr verändere sich beim Kind so viel wie in keinem anderen Lebensjahr. Aber auch später noch finde im kindlichen Verhalten „eine beeindruckende Fülle von Veränderungen“ statt.
Störquellen bei der Entwicklung von Kindern seien Trennungserlebnisse, Wechsel der Bezugspersonen und eine gestörte Eltern-Kind-Interaktion, etwa durch mangelnde Feinfühligkeit. Dazu kommen, so die Entwicklungspsychologin, seit den 1980er Jahren „globale Megatrends“ wie gesellschaftliche, ökologische, wirtschaftliche politische und technologische Krisen, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu Hoffnungslosigkeit und dem Verlust von Zukunftsperspektiven führen. So würden in Deutschland als Folge der psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen durch Corona aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit Kosten in Höhe von 5,3 Milliarden Euro erwartet. In diesem Zusammenhang verwies Christiansen auf das im Aufbau befindliche Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG), ein Netzwerk aus Kooperationseinrichtungen für einschlägige Forschungsvorhaben, das eine Onlineplattform mit Informationsmaterial sowie ein nationales Frühwarnsystem für psychische Gesundheit bei Kindern & Jugendlichen aufbaue.
Spurensuche in Buddhismus und Islam
Auf eine „religionswissenschaftliche Spurensuche“ begab sich Dr. Simone Sinn, Professorin für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie an der Universität Münster, mit ihrem Vortrag „Kinder in Buddhismus und Islam. Religionswissenschaftliche Erkundungen“. Sinn kam zu dem Schluss, für den Buddhismus sei im Blick auf Kinder „das Themenfeld von Bindung und Freiheit“ bedeutsam, für den Islam dagegen bilde die „fitra“, die scheinbar naturgegebene Disposition des Menschen, Gott zu suchen und zu finden, einen grundlegenden Referenzpunkt für die Wahrnehmung von Kindern in ihrem Gottesverhältnis. Darüber hinaus sei im Islam das Annehmen und die Fürsorge für Kinder ein „Fenster zum Verständnis der Annahme und Fürsorge Gottes“.Der Entschluss des Buddha für ein asketisches Leben bedeute eine Zurückweisung der biologischen Familie und damit der biologischen Kinder als einer belastenden Bindung, Gleichwohl versuche man durch Bewusstseins- und Bildungsarbeit buddhistische Klöster zu sichereren Orten für Kinder zu machen. Auch der Gedanke, dass Kinder Subjekte des Glaubens sind, tauche im Buddhismus auf, aber auch die Angst vor der Rache der Geister verstorbener, oft abgetriebener, Kinder an den Lebenden, die sich an ihnen schuldig gemacht haben.
Der Islam sieht Gott als Schöpfer des Lebens und damit auch jeder einzelnen Person. Sinn: „Damit ist theologisch klar, dass jedes Kind von Gott gewollt ist.“ So habe sich der Überlieferung zufolge Mohammed aufmerksam und fürsorglich Kindern zugewandt, auf ihn gehe auch das Verbot von Kindersoldaten zurück. Neben der „fitra“, als ursprünglicher göttlicher Begabung beschrieb Sinn zwei weitere „Eckpfeiler“ der koranischen Tradition im Blick auf Kinder und Kindheit: Das Verbot, Kinder aus ökonomischer Notlage zu töten, und den Auftrag, für Kinder zu sorgen, denn Gott sage zu, dass er Eltern und Kinder versorgen wird. Damit bestehe die moralische Verpflichtung der Eltern, das Leben der Kinder zu schützen. Ebenso spiele Bildung im menschlichen Leben eine zentrale Rolle. „Doch zugleich“, so Sinn, „sind damit oft Illusionen der Freiheit verbunden, die verschleiern, wie sehr diese doch auch eingeschrieben sind in machtförmige Prozesse“.
Vom „Verlust der Naivität“ in der Philosophie bis zur Subjektorientierung in der Religionspädagogik: Wissenschaftliche Arbeiten junge Theologinnen und Theologen
Traditionsgemäß präsentieren auf der Tagung der Rudolf-Bultmann-Gesellschaft junge Theolog*innen ihre wissenschaftlichen Projekte. So stellt Johannes Böckelmann, Leipzig, die „Rede vom Verlust von Naivität und die Suche nach Naivität“ in den Mittelpunkt seiner Examensarbeit. Die Rede von der Naivität ist „als Beschreibung von Religion in der Moderne seit der Frühaufklärung zu finden“ und steht im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über Mythos. Relevant für die Theologie ist nach Böckelmann vor allem der Begriff der „zweiter Naivität“ bei Paul Ricœur. Letztlich liegt jedem wissenschaftlichen Denken immer mythisches zugrunde. Gleiches gilt im Falle der Mythentheorie. Böckelmann: „Die Rede vom Verlust und die Suche nach einer neuen Naivität ist ein moderner Mythos“. Paula Neven Du Mont, Wien, fragt in ihrer Dissertation, wie sich das trinitarische Gottesverständnis, dem sich Eberhard Jüngel, Wolfhart Pannenberg und Joseph Bracken auf jeweils unterschiedliche Weise verschreiben, auf ihr jeweiliges Verständnis von Gottes Macht auswirkt und welche Konsequenzen daraus für einen Begriff "trinitarischer Allmacht" gezogen werden können. Thalia Riedl, Kassel, geht in ihrem Dissertationsprojekt der Frage nach dem Verhältnis des irdischen Jesus zum geglaubten Christus bei Eberhard Jüngel nach. Dabei versteht sie die Differenz zwischen irdischem Jesus und geglaubten Christus als „innere theologische Notwendigkeit“ und denkt sie systematisch weiter. Und Dr. Julia Drube, München untersucht in ihrem Habilitationsprojekt hermeneutische Aspekte in der unterrichtlichen Tätigkeit und diskutiert „Die Theologizität der Religionspädagogik am Beispiel des Paradigmas der Subjektorientierung."Die Briefe Rudolf Bultmanns
In den 2023 erschienenen und von ihm herausgegebenen Briefband, der die Briefe Rudolf Bultmanns an seinen Freund und Kollegen Hans von Soden sowie die Briefwechsel mit seinen Schülern Philipp Vielhauer und Hans Conzelmann enthält, führte apl. Professor Werner Zager, Worms, ein. Zu den in den Briefen verhandelten Themen gehört das Verhältnis von historisch-kritischer Exegese und Systematischer Theologie, die Frage der Verbindung von dialektischer und liberaler Theologie sowie Theologie als Schriftauslegung. Auch die nach dem ersten Weltkrieg virulent gewordene Frage „Volkskirche oder Bekenntniskirche?“ wie auch die Schuldfrage nach dem Zweiten Weltkrieg spielen eine Rolle. Das Bild des Ehemanns und Vaters Rudolf Bultmann und seiner Empfänglichkeit für Eindrücke aus der Natur tritt ebenfalls in den Korrespondenzen hervor.(Rudolf Bultmann, Briefe an Hans von Soden, Briefwechsel mit Philipp Vielhauer und Hans Conzelmann, hg. v. Werner Zager, Tübingen 2023)
Christoph Weist
NEUERSCHEINUNG
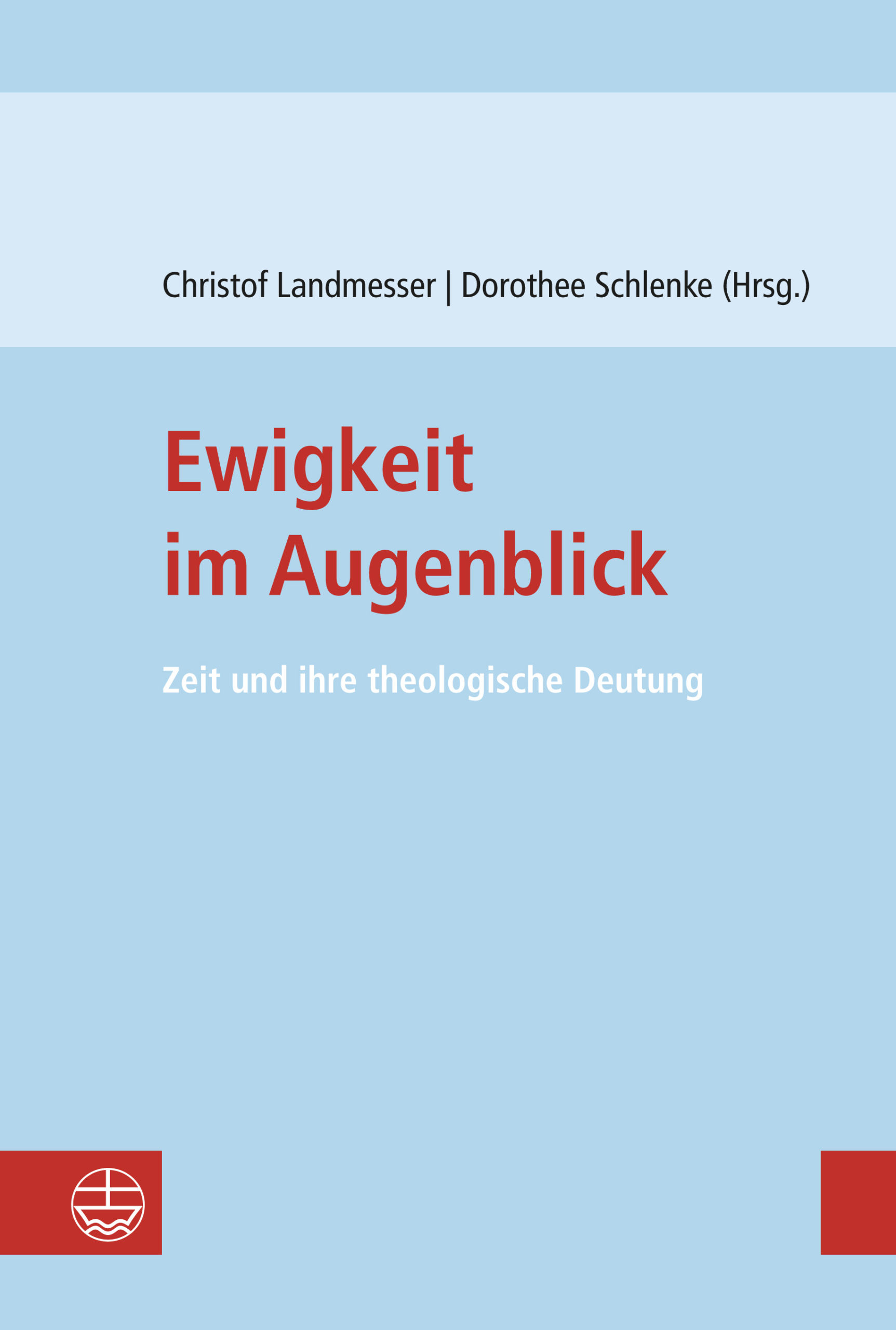
Ewigkeit im Augenblick
Zeit und ihre theologische Deutung
Herausgegeben von Christof Landmesser & Dorothee Schlenke
2024. 124 Seiten
ISBN: 978-3-374-07579-9
Weitere Informationen finden Sie hier.